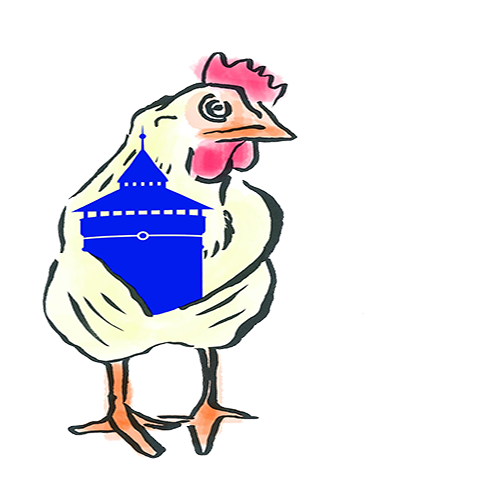


Ein Künstlerleben in Zeiten von Pest und Cholera
Für dieses ganz besondere Interview haben wir unsere Zeitmaschine angeworfen um einen der bekanntesten Menschen aus der Region zu treffen.
Grüß Sie, Herr Dürer, nach langer Zeit sind sie mal wieder hier in Nürnberg. Darf ich fragen, was denn der Anlass ist?
Ich habe eine Einladung von den Organisatoren für die Bewerbung Nürnbergs als Kulturhauptstadt Europas bekommen.
Da hat man Sie als Experten eingeladen?
Ja! Damals als ich hier gearbeitet habe, war Nürnberg zweifellos eine Hauptstadt, eine Metropole – sowohl was die Kunst und Kultur angeht als auch was Handel und Wirtschaft betrifft. Damals blickte ganz Europa nach Nürnberg. Ich denke also schon, dass ich einiges dazu beitragen konnte, um die Bewerbung weiterzubringen. Leider hat es ja dann doch nicht ganz geklappt (schüttelt den Kopf). Schade!
Als sie wieder nach Nürnberg gekommen sind, haben sie ihre Heimatstadt da gleich wiedererkannt?
Vieles hat sich hier schon verändert. Als ich hier lebte, hatte Nürnberg gerade mal 40.000 Einwohner, heute ist es rund zwölfmal so groß. Für damalige Verhältnisse war Nürnberg dennoch eine Großstadt von europäischem Rang – und das spürte man auch. Auf den Straßen traf man Kaufleute aus Italien, aus Prag oder dem Baltikum. Sie alle trieben hier Handel und machten unsere Stadt zu einer echten Metropole.

Das Spannende war aber, dass diese Menschen Ideen und Wissen aus ihrer Heimat mit nach Nürnberg brachten. Das hatte mich damals ungemein fasziniert, wenn ich mit meinem Vater – einem Goldschmied, der aus Ungarn hier nach Nürnberg gekommen war – durch die engen Gassen ging.
Wenn ich heute durch diese Gassen und über die Plätze schlendere, dann gibt es aber nur noch wenige Häuser von damals. Die Kirchen – gut, die meisten Kirchen sind immer noch da und natürlich unsere Kaiserburg. Mein Wohnhaus hab‘ ich auch gleich wiedergefunden, hier oben am Tiergärtnertorplatz. Es ist sogar noch prachtvoller und vor allem sauberer, als ich es von damals in Erinnerung habe. Ganz Nürnberg ist viel sauberer.
Sauberer?
Ja, das Nürnberg, das ich in meiner Erinnerung habe, war nicht so sauber. Ganz im Gegenteil. Damals lebten die Menschen zwischen den Stadtmauern hier viel enger beisammen. Viele von ihnen kamen von Land und benahmen sich überhaupt sich so, wie ihr euch das heute von einem Städter vorstellt. Sie warfen ihren Müll und ihre Fäkalien einfach auf die Straßen oder in die Pegnitz. Da kannst du dir vorstellen, wie das hier stank. Es war auch keine Seltenheit, dass die Stadtbewohner in den eigenen vier Wänden Schweine, Hühner und andere Tiere hielten und die dann auch zu Hause schlachteten.
Das sind ja fürchterliche hygienische Zustände, kein Wunder, dass sich damals Krankheiten ausbreiteten, dass die Menschen damals früh starben.
Den Tod war seinerzeit überall präsent. Das war nicht so wie heute, wo man am besten gar nicht über den Tod spricht. Nein, damals gehörte er einfach zum Leben dazu. Ich habe ihn im eigenen Haus immer wieder erlebt. Meine Mutter brachte 18 Kinder zur Welt, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber nur drei von ihnen überlebten.
Und dann waren da die ganzen Seuchen, die vor allem auch von den vielen Besuchern nach Nürnberg hereingeschleppt wurden. Die konnten sich dann wegen der katastrophalen hygienischen Verhältnisse schnell ausbreiten – die Cholera, Lepra und vor allem die Pest. Rund ein Drittel der Menschen fiel damals der Beulen- oder Lungenpest zum Opfer.

Aber es gab doch damals schon beheizte Badehäuser, in denen sich die Menschen waschen und reinigen konnten.
Ja, die gab es schon. Fast jedes Dorf in Franken hatte damals sein eigenes Badehaus – so an die 1.200 waren es seinerzeit. Ich habe ein paar sehr schöne Holzschnitte angefertigt, in denen ich Szenen aus den Badehäusern wiedergegeben habe. (schmunzelt)
Diese Badehäuser waren gut für die Hygiene, aber sie sorgten andererseits auch dafür, dass sich die Seuchen noch schneller ausbreiten konnten. Denn unter den Besuchern – seien es Bürger, Bauern oder Gesinde – befanden sich natürlich auch viele Kranke. Die Feuchtigkeit und Wärme, die in den Badehäusern herrschte, sorgten dann dafür, dass sich die Krankheitserreger noch schneller ausbreiteten.
Und was machte man, wenn zum Beispiel die Pest in der Stadt war?
Wenn man die Seuche erst einmal in der Stadt hatte, war es schwierig, etwas dagegen zu tun. Auch wir hier in Nürnberg wurden immer wieder von solchen Pestwellen heimgesucht – 1348, 1437 und dann auch zu meinen Lebzeiten 1483, 1491 und 1522. Jedes Mal gab es Tausende und Abertausende von Toten. Aus diesem Grund richtete man damals Pesthäuser ein, in denen die Kranken isoliert wurden, damit sie niemanden mehr anstecken konnten. Phasenweise wurde es auch verboten, in Kirchen, auf Märkte und auf Feste zu gehen. Die Leute waren natürlich nicht begeistert – aber was wollte man tun – die Pest ging nunmal um.
Am besten war es aber, die Pest erst gar nicht in die Stadt kommen zu lassen. Als ich auf einer meiner Italienreisen nach Venedig kam, 1505 oder so muss das gewesen sein, erzählte man mir, dass man dort eine ganz gute Lösung gefunden habe, um die Seuche aus der Stadt zu halten. Ankommende Schiffe wurden 40 Tage lang isoliert. Die Schiffe lagen in dieser Zeit im Hafen vor Anker, die Besatzung durfte aber nicht an Land. Abgeleitet von der Zahl 40 – auf italienisch: quaranta – nannten das die Venezianer „Quarantäne“.
Auf diese Weise konnte man die Pest tatsächlich aus der Stadt halten?
Schön wäre es. Händler mit genügend Geld konnten sich von der Quarantäne freikaufen und so gelangte der „schwarze Tod“ letztendlich doch nach Venedig und von dort über den Brenner zu uns nach Deutschland und auch hier nach Nürnberg.
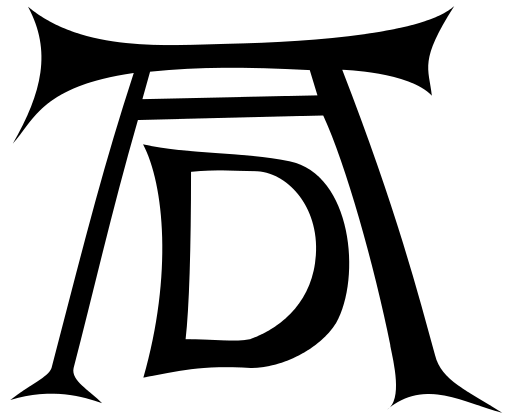
Über Albrecht Dürer
Albrecht Dürer zählt als einer der wichtigsten Vertreter der Renaissance. Sein Werke sind in den berühmtesten Museen der Welt ausgestellt, darunter die Albertina in Wien, die Eremitage in St. Petersburg und das Louvre in Paris. Die Meisten seiner Werke ziert dabei etwas, das in der damaligen Zeit absolut ungewöhnlich war: Seine Signatur. Der alte Meister suchte nämlich nach Wegen seine Werke vor Kunstfälscher abzusichern. Dabei schafft er ein simples aber elegantes Design, das bis heute in Fachkreisen als Anschauungsbeispiel dient.
Wie reagierte man denn in Nürnberg auf die Pandemie?
Ach, da gab es ganz unterschiedliche Reaktionen. Wer es sich leisten konnte, die Bessergestellten also, flüchtete auf‘s Land, um der Epidemie zu entgehen. Wer bleiben musste, verbrannte in seinem Haus Kräuter und Räuchermittel, Priester versuchten sich durch Kerzen zu schützen und die Pestheiligen Rochus und Sebastian erfreuten sich großer Beliebtheit. In der Lorenzkirche zum Beispiel hatten sie anlässlich der Pest 1483/84 einen Holzalter zum Beten gegen die Pest aufgebaut. St. Rochus, war darauf dargestellt, wie er auf eine Pestbeule an seinem Oberschenkel deutet. Ich glaube, man kann ihn heute noch im rechten Kirchenschiff sehen.
Weit verbreitet war damals auch die Vorstellung, dass die Pest durch verdorbene Luft ausgelöst sei. Diesem Pesthauch versuchte man durch Masken mit einer schnabelartigen Nase entgegenzuwirken. In diesen langen, spitzen Nasen war ein mit duftenden Essenzen getränkten Schwamm, der die Atemluft mit dem aromatischen Geruch von Zimt oder Nelken veredelte und so den Pesthauch abhalten sollte.
Gestorben wurde aber weiter…
Ja, und so wurden die neuen Pestfriedhöfe, der Rochusfriedhof und der Johannisfriedhof, nach außerhalb der Stadtmauern gelegt. Pest-Fuhrleute, mit Umhang und Kapuze, fuhren Tag für Tag die Toten auf ihren Karren aus der Stadt. Dazu gab es auch eine schöne Geschichte ein, die man sich seinerzeit erzählte.

Könnten sie uns diese Geschichte kurz erzählen?
Die Geschichte handelt von einem Dudelsackpfeifer, der den Gästen in Nürnberger Gastwirtschaften aufspielte. Er war aber nicht nur ein guter Musiker, sondern auch ein begnadeter Trinker und investierte seinen Lohn gleich vor Ort in Bier und Wein. Eines Nachts trank er wohl doch einen Krug zuviel, fiel auf dem Nachhauseweg in den Straßenkot und schlief ein.
Die Pest-Fuhrleute, die zufällig vorbeikamen, nahmen natürlich an, er sei ein Pesttoter und warfen ihn kurzerhand auf ihren Pest-Karren. Durch das Rumpeln des Karrens wachte der Dudelsackpfeifer wenig später wieder auf. Doch er war zwischen den Toten eingeklemmt und konnte sich – so sehr er sich auch mühte – nicht befreien. Zum Glück kam er an das Mundstück seines Dudelsacks und begann ein paar Lieder zu spielen, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Fuhrleute und die Menschen, die den Karren sahen, erschraken natürlich ganz fürchterlich.
Als man draußen am Friedhof die Toten über ihm entfernt hatte, konnte sich der Dudelsackpfeifer endlich befreien und rannte wie der Blitz davon. Er hatte sich auch durch den Kontakt mit den Toten auf dem Karren nicht angesteckt und überlebte die Pestwelle – man sagte später, der Alkohol hätte eine Ansteckung verhindert.
Eine wunderschöne Geschichte…
Ja, aber wissen sie eigentlich, dass ich einen sehr schönen Kupferstich von diesem Dudelsackpfeifer gefertigt habe und – das hat man mir erst vor kurzem erzählt – dass es am Unschlittplatz sogar einen Brunnen mit einem Dudelsackpfeifer gibt, der meinem Bild sehr ähnlich sehen soll?
Den werde ich mir jetzt gleich noch ansehen. Vielen Dank für diesen interessanten Ausflug in die Vergangenheit, der leider gar nicht so wenig mit unserer Welt von heute zu tun hat.
